Vortrag
Rilke und Russland
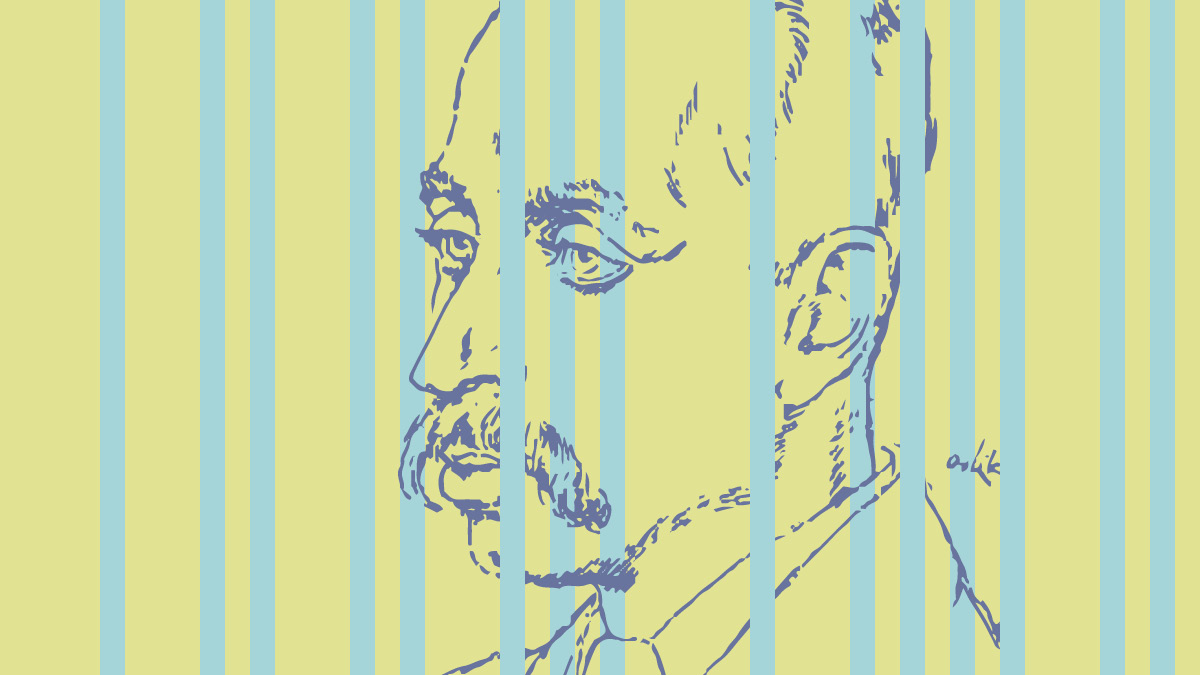
nach Emil Orlik
Lilia Antipow widmet sich anhand des gemeinsamen Briefwechsels der Beziehung zwischen Rainer Maria Rilke, Marina Zwetajewa und Boris Pasternak.
Der Vortrag beschreibt die außergewöhnliche Verbindung zwischen den europäischen Dichtern Rainer Maria Rilke, Marina Zwetajewa und Boris Pasternak im Jahr 1926. Durch ihre Briefe entwickelten sie eine tiefgehende, komplexe Beziehung, geprägt von spiritueller Nähe, künstlerischem Austausch und einer romantischen Liebe zum Unerreichbaren. Diese Briefbeziehung war von gegenseitiger Bewunderung, geistiger Verbundenheit und emotionaler Sehnsucht geprägt, wobei ihr Ende die Biografien von Zwetajewa und Pasternak maßgeblich beeinflusste.
Rilke, damals 50 Jahre alt, begann im Mai 1926 einen Briefwechsel mit den beiden russischen Dichtern, die bereits freundschaftlich miteinander verbunden waren. Die Korrespondenz wurde auf Deutsch geführt, während Zwetajewa und Pasternak untereinander auf Russisch kommunizierten. Ziel war die Überwindung ihrer Einsamkeit und die Suche nach geistiger Nähe. Rilke hatte Russland bereits als „geistigen Ort“ entdeckt, Zwetajewa und Pasternak waren durch deutsche Literatur und Kultur sowie durch Reisen nach Deutschland kulturell geprägt. Der Austausch basierte auf Seelenverwandtschaft und Freundschaft, wobei die Liebe zu Unerreichbarem im Vordergrund stand. Zwetajewa idealisierte im Sinne der Neoromantik die geistige Liebe. Die Briefe zeichnen sich durch einen besonderen Ton und Rhythmus aus, die ihren „Atem“ und „Geist“ widerspiegeln, wobei die erotisch aufgeladene Rhetorik eher als Code für geistige Liebe zu verstehen ist. Anfangs reagierte Rilke vertraulich, doch im Sommer 1926 veränderte sich die Dynamik: Zwetajewa mystifizierte Rilke, ignorierte seine Krankheit und stellte Pasternak als Konkurrenz dar. Nach Rilkes Tod 1926 war Zwetajewa tief erschüttert, die Beziehung zu Pasternak erlahmte, und der Briefwechsel – jetzt zwischen den beiden – verlor an Intensität.
Lilia Antipow ist Historikerin, Slawistin, Übersetzerin sowie Ausstellungs- und Filmkuratorin. Seit 2018 leitet sie die Öffentlichkeits-, Medien- und Pressearbeit sowie die Bibliothek im Haus des Deutschen Ostens. Zu ihren zahlreichen Veröffentlichungen gehören unter anderem Wozu das ganze Theater? (2011), Der lange Abschied von der Unmündigkeit. Aleksandr Tvardovskij (1911–1971) (2022), Schlüsseljahre. Zentrale Konstellationen der Mittel- und osteuropäischen Geschichte (zusammen mit Matthias Stadelmann, 2011), sowie zusammen mit Andreas Otto Weber und Patricia Erkenberg: Wer bin Ich? Wer sind Wir? (2023) und Ungehört. Die Geschichte der Frauen (2024).
Dies ist der dritte Abend einer dreiteiligen Reihe, zu der auch zwei weitere Vorträge – Rilke und Böhmen (4. Dezember 2025) sowie Rilke und München (29. Januar 2026) – gehören.
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins – Kulturinstitut für die böhmischen Länder und des Hauses des Deutschen Ostens.
